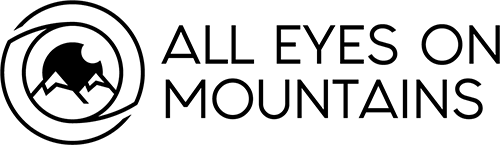Wenn Du verdreckten Schuhen, Schweiss auf der Stirn und einem breiten Grinsen im Gesicht den Lauf über Feld-, Wald- und Bergewege beendest, dann hast du mehr für deine Gesundheit gemacht als nur "ein bisschen Joggen".
Deine Emotionen dank Glückshormonen und das positive Körpergefühl im Anschluss an den Trip mit Auf- und Abstiegen bestätigen das, was die Wissenschaft in ihren Forschungen bestätigt: Trailrunning steht dem klassische Strassenlauf in nichts nach. Im Gegenteil. Es gibt gute Gründe, eine Runde in hügeligem Naturgelände dem Asphalt vorzuziehen. Warum? Lass uns das mal locker durchlaufen.
1. Weniger ist mehr – zumindest beim Aufprall
Trailrunning belastet deinen Körper weniger stark als ein Lauf auf Asphalt. Auf natürlichen Trails hingegen wirkt der Boden dämpfend. Straßenläufer knallen sich den Aufprall mit bis zu drei- bis vierfachem Körpergewicht in die Gelenke. Waldboden, Wiesen, Wurzelwerke und weicher Untergrund hingegen reduzieren die Stossbelastung pro Schritt – das schont den Bewegungsapparat und beugt klassischen Laufverletzungen vor. Deine Knie, Deine Bandscheiben und alle anderen Gelenke lieben Dich dafür. Wer also nicht möchte, dass sein Bewegungsapparat mit der Kündigung droht, sollte regelmässig auf natürliche Untergründe ausweichen.
2. Multitasking für Deine Muskulatur
Auf einem Trail gleicht kein Schritt dem anderen – genau das macht’s so effektiv und abwechslungsreich. Du arbeitest dabei nicht nur mit den üblichen Verdächtigen wie Waden und Oberschenkel. Ständiges Anpassen an Bodenunebenheiten, Steigungen und Richtungswechsel sorgt dafür, dass ständig kleine Ausgleichsbewegungen nötig sind. Das aktiviert nicht nur die Beinmuskulatur, sondern auch tieferliegende Muskelgruppen, deinen Rumpf und selbst der faule Gluteus Maximus (aka Po) wird zum Leistungsträger. Es arbeiten Strukturen, die auf der Strasse eher im Stand-by-Modus bleiben. Wissenschaftler nennen das „propriozeptives Training“ – wir nennen es einfach: Unterhaltsam!
3. Mehr Natur, weniger Stress
Psychologisch betrachtet ist der Effekt ebenso deutlich: Wer durch den Wald läuft, atmet nicht nur sauberere Luft, sondern reduziert auch den Stresspegel messbar. Untersuchungen zeigen, dass ein Aufenthalt in der Natur die Produktion des Stresshormons Cortisol senkt und gleichzeitig das subjektive Wohlbefinden steigert. Läufer:innen auf dem Trail berichten häufig von einem meditativen Zustand – Flow-Zustände treten hier schneller und intensiver auf als beim Strassenlauf. Mit anderen Worten: Der Trail ist nicht nur gut für den Kreislauf, sondern auch für die innere Balance – quasi ein Dauerabo auf mentale Frischluft.
4. Bewegungsvielfalt statt monotoner Reiz
Eintönige Bewegungsmuster gelten als Hauptursache für Überlastungsschäden im Laufsport. Wer immer nur geradeaus läuft, überfordert auf Dauer genau die Strukturen, die jedes Mal gleich beansprucht werden. Trails dagegen fordern ständig neue Bewegungsformen: kurze Schritte bergauf, kontrolliertes Abbremsen bergab, Ausweichbewegungen um Steine und Wurzeln. Das reduziert das Verletzungsrisiko durch Überlastung und macht das Training zugleich abwechslungsreicher. Verglichen mit dem Strassenlauf ist Trailrunning also weniger wie ein Fliessbandjob – und mehr wie ein dynamischer Team-Workshop für die Muskulatur.
Fazit: Gesund ist, was Vielfalt bringt
Trailrunning ist nicht nur ein Laufsport, sondern ein Invest in funktionelle Fitness, psychische Resilienz und gelenkschonende Bewegung. Und ja – ein bisschen Schmutz gehört dazu. Aber genau darin liegt der Reiz: Statt Perfektion zählt hier Anpassungsfähigkeit.
Wer also seinem Körper und Geist langfristig etwas Gutes tun will, sollte den Trail nicht als Ausnahme, sondern als neue Norm betrachten.
📚 Buchtipp
„Born to Run“ von Christopher McDougall
Ein mitreißendes Buch über die Kunst des natürlichen Laufens, das Trailrunning als Ursprung und Zukunft des gesunden Laufens zeigt. Wissenschaftlich fundiert, spannend erzählt – Pflichtlektüre für alle, die mehr wollen als nur Kilometer auf Asphalt.
Quellen:
Hreljac, A. (2004). Impact and overuse injuries in runners. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36(5), 845–849.
Millet, G. P., & Millet, G. Y. (2012). Trail running: From specific constraints to training programming. Science & Sports, 27(2), 55–63.
Thompson Coon, J., et al. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? Environmental Science & Technology, 45(5), 1761–1772.
Schütz, U. H. W., & Ehrlenspiel, F. (2020). Psychologische Effekte des Trailrunnings – eine qualitative Analyse. Zeitschrift für Sportpsychologie, 27(4), 168–179.
Van Gent, R. N., et al. (2007). Incidence and determinants of lower extremity running injuries in long distance runners: A systematic review. British Journal of Sports Medicine, 41(8), 469–480.
Hinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links Bücher kaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Foto: Credits für Brian Erickson auf Unsplash